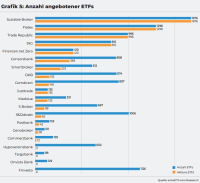Rückvergütung: Deutschland stellt sich gegen EU-Kommission
Im vergangenen Jahr war bekannt geworden, dass die EU ein Verbot des sogenannten „Payment for Order Flow“ plant. Die Umsetzung sollte über die anstehende MiFID-Überarbeitung erfolgen (AssCompact berichtete). Zum Handeln berufen fühlte sich die EU-Kommission deshalb, weil der Verdacht im Raum stand, Broker und insbesondere Neobroker wie Scalable Capital, könnten bei der Auswahl des Handelsplatzes gegen das Kundeninteresse agieren. Der Broker habe bei „Payment for Order Flow“ nämlich ein Interesse daran, nicht den für den Kunden günstigsten Handelsplatz zu wählen, sondern denjenigen, der die höchste Rückvergütung verspricht.
Studie registriert keine Nachteile für Anleger
Diesem Verdacht trat unter anderem der Marktführer auf dem deutschen Neobroker-Markt entgegen. Trade Republic belegte mit der Studie, dass seinen Kunden durch die Rückvergütung keine Kostennachteile bei den Ausführungskursen entstünden.
Deutschland stemmt sich gegen EU-Kommission
Nun hat die Interessenvertretung der deutschen Neobroker wohl einen Durchbruch zu verbuchen. Laut Informationen des Branchendienstes finanz-szene.de stemmt sich Deutschland gegen das von der EU-Kommission geplante Verbot von Rückvergütungsmodellen.
BMF bestätigt Urheberschaft
finanz-szene.de zitiert in diesem Zusammenhang aus einem vertraulichen Positionspapier der Bundesregierung, in dem es deutlich heißt: „Germany strongly opposes the inclusion of the general ban on payment for forwarding client orders for execution.” Eine Sprecherin des Bundesfinanzministeriums bestätigte gegenüber dem Branchendienst, dass das Papier aus ihrem Haus stamme, wollte aber nicht weiter Stellung beziehen.
Bestehende Regulierung ausreichend
Die im Positionspapier genannte „deutsche Delegation“ bestreite zwar nicht, dass die Rückvergütung der Market Maker an die Broker einen Interessenkonflikt darstelle. Die bestehenden regulatorischen Rahmenbedingungen seien jedoch ausreichend, um eine Benachteiligung der Kunden zu verhindern.
Rückschlag für aufkeimende Aktienkultur
Außerdem wird in dem Papier die Meinung vertreten, dass ein Verbot der Rückvergütung einen herben Rückschlag für Privatanleger darstellen könnte. Immerhin hätten allein in Deutschland in den vergangenen Jahren zwei Millionen Anleger erstmals in den Aktienmarkt investiert. Das sei zu einem signifikanten Anteil auf den Erfolg der Neobroker zurückzuführen.
„Payment for Order Flow“ unerlässlich
Das Prinzip „Payment for Order Flow“ ist für das Geschäftsmodell der Neobroker unerlässlich. Zwar erhalten auch andere Anbieter eine derartige Rückvergütung der jeweiligen Market Maker. Die Neobroker sind allerdings auf diese Kickbacks angewiesen, da sie andernfalls nicht derart niedrige oder sogar keine Ordergebühren verlangen könnten. Ein Verbot der Rückvergütung würde dementsprechend das Geschäftsmodell der Neobroker gefährden. (tku)
Bild: © Vlad – stock.adobe.com