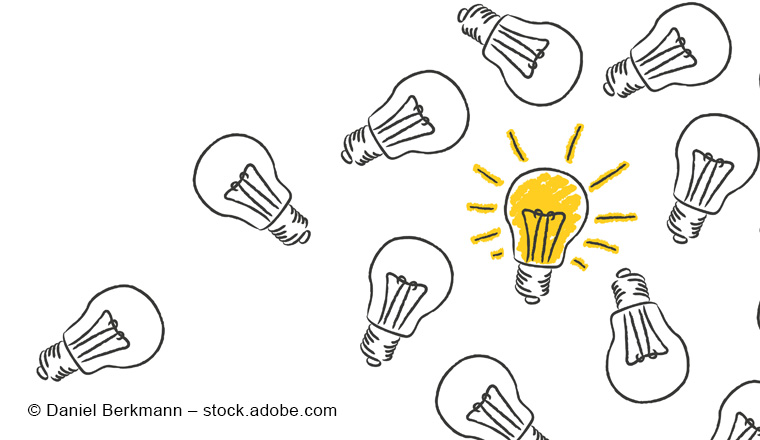Der Inhaber eines Hotel- und Gastronomiebetriebs musste aufgrund des am 22.03.2020 vom Land Brandenburg erlassenen Corona-Eindämmungsverordnung sein Gewerbe für den Publikumsverkehr schließen. Im Zeitraum vom 23.03.2020 bis zum 07.04.2020 war sein Betrieb geschlossen, ohne dass die Covid-19-Krankheit zuvor dort aufgetreten war. Auch der Mann selbst erkrankte nicht. Während der Zeit der Schließung seiner Gaststätte bot er Speisen und Getränke im Außerhausverkauf an. Im Rahmen eines staatlichen Soforthilfeprogramms zahlte die Investitionsbank Brandenburg 60.000 Euro als Corona-Soforthilfe an ihn aus.
Der Gastro-Betreiber hat geklagt und dabei geltend gemacht, dass es verfassungsrechtlich geboten sei, ihn und andere Unternehmer für die durch die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie erlittenen Umsatz- und Gewinneinbußen zu entschädigen.
Der bisherige Prozessverlauf
Das Landgericht hat die auf Zahlung von 27.017,28 Euro (Verdienstausfall, nicht gedeckte Betriebskosten, Arbeitgeberbeiträge zur Kranken-, Renten- und Pflegeversicherung) nebst Prozesszinsen sowie auf Feststellung der Ersatzplicht des beklagten Landes Brandenburg für alle weiteren entstandenen Schäden gerichtete Klage abgewiesen. Auch vor dem Oberlandesgericht ist die Berufung des Klägers erfolglos geblieben.
Die Entscheidung des Bundesgerichtshofs
Der BGH hat die Revision des Klägers nun ebenfalls zurückgewiesen und dabei folgendermaßen argumentiert: Die Entschädigungsvorschriften des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) gewähren Gewerbetreibenden, die im Rahmen der Bekämpfung der Covid-19-Pandemie aufgrund von Betriebsschließung oder -beschränkung wirtschaftliche Einbußen erlitten haben, weder in unmittelbarer noch in entsprechender Anwendung einen Anspruch auf Entschädigung.
Der Kläger könne den geltend gemachten Entschädigungsanspruch auch nicht auf eine analoge Anwendung von § 56 Abs. 1 oder § 65 Abs. 1 IfSG stützen. Hier fehle es bereits an einer planwidrigen Regelungslücke. Den infektionsschutzrechtlichen Entschädigungstatbeständen liege, was sich insbesondere aus ihrer Entstehungsgeschichte und der Gesetzgebungstätigkeit während der Corona-Pandemie ergebe, die abschließende gesetzgeberische Entscheidung zugrunde, Entschädigungen auf wenige Fälle punktuell zu begrenzen und Erweiterungen ausdrücklich ins Gesetz aufzunehmen („Konzept einer punktuellen Entschädigungsgewährung“). Darüber hinaus fehle es auch an der Vergleichbarkeit der Interessenlage zwischen den Entschädigungsregelungen nach §§ 56, 65 IfSG und flächendeckenden Betriebsschließungen, die auf gegenüber der Allgemeinheit getroffenen Schutzmaßnahmen beruhen.
Über das Sozialstaatsprinzip
Hilfeleistungen für von einer Pandemie schwer getroffene Wirtschaftsbereiche sind ferner laut BGH-Urteil keine Aufgabe der Staatshaftung. Vielmehr folge aus dem Sozialstaatsprinzip, dass die staatliche Gemeinschaft Lasten mittrage, die aus einem von der Gesamtheit zu tragenden Schicksal entstanden seien und nur zufällig einen bestimmten Personenkreis träfen. Hieraus folge zunächst nur die Pflicht zu einem innerstaatlichen Ausgleich, dessen nähere Gestaltung weitgehend dem Gesetzgeber überlassen sei. Erst eine solche gesetzliche Regelung könne konkrete Ausgleichsansprüche der einzelnen Geschädigten begründen. Dieser sozialstaatlichen Verpflichtung könne der Staat zum Beispiel dadurch nachkommen, dass er – wie im Fall der Corona-Pandemie geschehen – haushaltsrechtlich durch die Parlamente abgesicherte Ad-hoc-Hilfsprogramme auflege („Corona-Hilfen“), die die gebotene Beweglichkeit aufwiesen und eine lageangemessene Reaktion beispielsweise durch kurzfristige existenzsichernde Unterstützungszahlungen an betroffene Unternehmen erlaubten.
Corona-Eindämmungsverordnungen waren rechtmäßig
Ansprüche aus Amtshaftung (§ 839 Abs. 1 Satz 1 BGB i.V.m. Art. 34 GG) und enteignungsgleichem Eingriff sowie nach § 1 Abs. 1 des Staatshaftungsgesetzes des Landes Brandenburg hat das Berufungsgericht zu Recht abgelehnt. Die Corona-Eindämmungsverordnung vom 22.03.2020 und die Folgeverordnungen vom 17. und 24.04.2020 waren als solche rechtmäßig. Die getroffenen Schutzmaßnahmen, insbesondere die angeordneten Betriebsschließungen, waren erforderlich, um die weitere Ausbreitung der Covid-19-Krankheit zu verhindern. Dies wurde von der Revision auch nicht in Frage gestellt. (ad)
BGH, Urteil vom 17.03.2022 – III ZR 79/21
Bild: © vegefox.com – stock.adobe.com
- Anmelden, um Kommentare verfassen zu können