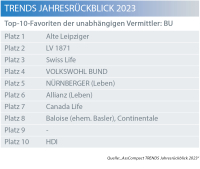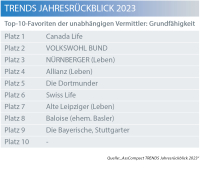Ein Beitrag von Dr. Arnd Böhmer, LL.M., Rechtsanwalt bei der Kanzlei Voigt Rechtsanwalts GmbH
Seit der Bundesgerichtshof (BGH) vor vielen Jahren zu der Erkenntnis gelangte, dass der durchschnittliche Versicherungsnehmer gar nicht in der Lage ist, Versicherungsbedingungen wie Gesetze auszulegen, gilt der Satz in Stein gemeißelt: „Allgemeine Versicherungsbedingungen sind so auszulegen, wie ein durchschnittlicher Versicherungsnehmer sie bei verständiger Würdigung, aufmerksamer Durchsicht und unter Berücksichtigung des erkennbaren Sinnzusammenhangs verstehen kann.“ Wie schwer es sogar Obergerichten fällt, dieses Postulat umzusetzen zeigt ein Fall, den das Oberlandesgericht (OLG) Dresden (Beschluss vom 12.10.2022, Az. 4 U 673/22) zu entscheiden hatte.
Was war geschehen?
Was war passiert: Die Klägerin unterhielt eine Berufsunfähigkeitsversicherung (BU). Hier war es aber so, dass sich die Definition des Versicherungsfalles ganz erheblich von den am Markt etablierten Bedingungswerken unterschied.
In § 15 des Bedingungswerkes stand: „Als berufsunfähig ist derjenige anzusehen, der durch körperliche Gebrechen oder wegen Schwäche seiner körperlichen oder geistigen Kräfte unfähig ist, eine seiner Vorbildung und seiner bisherigen Tätigkeit entsprechenden Beschäftigung auszuüben.“
Die Klägerin erkrankte an Brustkrebs. Sie wurde operiert, bestahlt und war vom 13.12.2017 bis zum 23.09.2018 durchgehend arbeitsunfähig. In Anbetracht der Diagnose darf wohl unterstellt werden, dass die Klägerin in dem zuvor skizzierten Zeitfenster auch nicht in der Lage war, ihrem zuletzt ausgeübten Beruf als Kundenberaterin oder einer Vergleichstätigkeit in einem mindestens halbschichtigen Umfang nachzugehen.
Die verklagte Versicherung sah sich aus mehreren Gründen als leistungsfrei an. Im Kern argumentierte sie aber, dass die gesundheitlichen Einschränkungen nicht dauerhaft vorgelegen hätten. Die Klägerin vertrat die Auffassung, dass es darauf nicht ankomme, da das Bedingungswerk keine Dauerhaftigkeit fordere. Das Landgericht hatte die Klage abgewiesen. Nun musste sich das OLG mit den Argumenten befassen.
So bewertete das OLG das Bedingungswerk
Zunächst räumten die Richter ein, dass Brustkrebs eine schwere Erkrankung sei. Es stelle sich aber die Frage, ob diese Erkrankung zu dauerhaften Leistungseinschränkungen führe. Dies sei unter Berücksichtigung des oben genannten Grundsatzes zu ermitteln, wonach es auf das Verständnispotenzial eines verständig lesenden, aber versicherungsrechtlich nicht vorgebildeten Versicherungsnehmers ankomme. Das Gericht räumte ein, dass in dem zugrunde liegenden Bedingungswerk nichts über die leistungsauslösende Dauer der Berufsunfähigkeit stehe. Das sei aber auch entbehrlich, da sich das Erfordernis der Dauerhaftigkeit sowohl aus der gesetzlichen Definition der Berufsunfähigkeit als auch aus dem Versorgungscharakter der BU, die typischerweise gegen dauerhafte Einkommenseinbußen absichern will, ergebe. Überprüfen wir beide Argumente.
Bewertung des Beschlusses
Der Begriff der Berufsunfähigkeit ist in § 172 Abs. 2 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) definiert. Dort heißt es: „Berufsunfähig ist, wer seinen zuletzt ausgeübten Beruf, so wie er ohne gesundheitliche Beeinträchtigung ausgestaltet war, infolge Krankheit, Körperverletzung oder mehr als altersentsprechendem Kräfteverfall ganz oder teilweise voraussichtlich auf Dauer nicht mehr ausüben kann.“
Wenn nun der Begriff der Berufsunfähigkeit das Dauerhaftigkeitskriterium immanent in sich tragen würde, dann hätte der Gesetzgeber mit der vorzitierten Legaldefinition bewusst eine Tautologie ins VVG geschrieben. Dafür gibt es jedoch überhaupt keinen Anhaltspunkt.
Ein weiteres Problem stellt sich. Der BGH hat in ständiger Rechtsprechung entschieden, dass sich der Sinn der Versicherungsbedingungen „aus sich heraus“ ohne Heranziehung anderer Texte ergeben müsse. Das heißt vereinfacht, ein Versicherungsnehmer muss nur den Bedingungstext lesen, den Gesetzestext muss er hingegen nicht kennen.
BU und Krankentagegeldversicherung (KTG) sind wichtige Vorsorgeprodukte gegen biometrische Risiken. Sie stammen aus verschiedenen Sparten (die BU wird von einer Lebensversicherung angeboten, die KTG schließt man bei einer Krankenversicherung ab) und können gegenseitig eine sinnvolle Ergänzung darstellen. Die KTG leistet bereits bei sehr kurzfristiger, gesundheitsbedingter Einschränkung der Arbeitskraft. Wenn diese Einschränkungen regelmäßig über sechs Monate bestehen, kann man Leistungen aus der BU beziehen. Der parallele Bezug von BU- und KTG-Leistungen schließt sich aber aus (§ 15 Abs. 1 Buchst. b) Musterbedingungen 2009 für die Krankentagegeldversicherung). Das alles ist dem Versicherungsprofi geläufig. Es ist aber mehr als fraglich, ob man diese Systematik ausschließlich aus dem eingangs zitierten Bedingungstext entnehmen kann.
Abschließend meint das OLG:
Es komme im Ergebnis gar nicht darauf an, denn wäre die Versicherungsbedingung unklar, würde § 172 Abs. 2 VVG gelten, und dieser erfordere nun mal die Dauerhaftigkeit. Diese Ausführung ist aber AGB-rechtlich nicht haltbar. Wenn eine Regelung unklar oder mehrdeutig ist, gilt die für den Verwender – also vorliegend die Versicherung – ungünstigste Auslegungsmöglichkeit. (§ 305c Abs. 2 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)). Mithin wäre auch eine kurze Gesundheitseinschränkung leistungsauslösend. Das Gesetz tritt erst dann an die Stelle der Versicherungsbedingung, wenn diese unwirksam ist, weil nicht mehr sinnerhaltend auslegbar (§ 306 Abs. 2 BGB). Doch das ist vorliegend sicherlich nicht der Fall.
Laie hätte Leistungspflicht annehmen können
Aus der Perspektive des versicherungsrechtlichen Laien hätte man vorliegend – nur basierend auf der nüchternen Lektüre des Bedingungstextes – eine Leistungspflicht annehmen müssen.
Besonders bemerkenswert ist aber folgender Aspekt: Es ist nicht auszuschließen, dass der Klägerin diese Versicherung empfohlen wurde, weil bei dieser Versicherung gerade die Dauerhaftigkeit der Einschränkung nicht gefordert ist. Bei den meisten Versicherungsbedingen ist der Versicherungsfall Berufsunfähigkeit ähnlich definiert wie in § 172 Abs. 2 VVG. Da aber in der Versicherungswirtschaft bekannt ist, dass diese Dauerhaftigkeitsprognose sehr schwer zu führen ist, erhalten fast alle am Markt erhältlichen BU-Produkte eine Beweiserleichterung: Erreichen oder überdauern die gesundheitlichen Leistungseinschränkungen einen Sechsmonatszeitraum, wird die Berufsunfähigkeit fingiert und der Versicherer ist zur Leistung verpflichtet.
Die versicherte Person war im vorliegenden Fall für ca. neun Monate gesundheitlich eingeschränkt. Das heißt, eine BU mit den Musterbedingungen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. (GDV) hätte in dieser Fallkonstellation, wenn auch nur temporär, leisten müssen. Die Klägerin hatte also einen nach dem Bedingungswortlaut besonders guten Versicherungsschutz, steht aber im Ergebnis schlechter da als der normale Versicherte. Aber auch diese Überlegung konnte der Klägerin im Ergebnis nicht helfen.
Diesen Artikel lesen Sie auch in AssCompact 01/2024 und in unserem ePaper.
Bild: © NewFabrika – stock.adobe.com