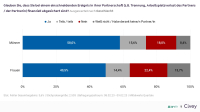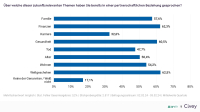Artikel von Björn Thorben M. Jöhnke, Fachanwalt für Versicherungsrecht und Partner der Kanzlei Jöhnke & Reichow Rechtsanwälte
Verjähren die Ansprüche gegen den Versicherer aus der Berufsunfähigkeitsversicherung, so kann der Versicherungsnehmer sie nicht mehr geltend machen. Doch wann und unter welchen Voraussetzungen verjähren die Ansprüche? Was ist unter einer sogenannten Stammrechtsverjährung zu verstehen? Und wie wirken sich Meldefristen im Vertrag auf die Verjährung aus? Diese und weitere Frage werden im Folgenden erläutert.
Wann verjähren vertragliche Ansprüche?
Die versicherungsvertraglichen Ansprüche verjähren nach den allgemeinen Regelungen. Damit gilt grundsätzlich die regelmäßige Verjährungsfrist von drei Jahren gemäß §§ 195, 199 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB). Sie beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den anspruchsbegründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste. Die Entstehung des Anspruchs setzt wiederum die Fälligkeit des versicherungsrechtlichen Anspruchs voraus.
Ein Anspruch ist entstanden, sobald er erstmals geltend gemacht und notfalls mit einer Klage durchgesetzt werden kann. Es muss also Klage auf sofortige Leistung erhoben werden können. Geldleistungen des Versicherers sind jedenfalls mit Beendigung der zur Feststellung des Versicherungsfalls und des Umfangs der Leistungspflicht des Versicherers notwendigen Erhebungen fällig. Damit ist in der Regel der Abschluss des Leistungsprüfungsverfahrens gemeint, also entweder das Anerkenntnis, der Zeitpunkt eines unterlassenen, aber gebotenen Anerkenntnisses oder die endgültige und umfassende Leistungsablehnung.
Was ist eine Stammrechtsverjährung?
In der Berufsunfähigkeitsversicherung ist zwischen dem Gesamtanspruch bzw. dem Stammrecht des Versicherungsnehmers als Grundlage für die Rentenzahlungen und den Ansprüchen auf die Einzelleistungen zu unterscheiden. Das sogenannte Stammrecht ist für die Verjährung von Berufsunfähigkeitsleistungen maßgeblich. Demzufolge verjähren die Ansprüche nicht abschnittsweise, sondern die Verjährungsfrist beginnt für alle Folgeleistungen, wenn die Leistungen erstmals fällig werden. Damit verjährt der Gesamtanspruch des geltend gemachten Versicherungsfalls insgesamt.
Meldefristen im Versicherungsvertrag?
Oftmals finden sich in den Versicherungsbedingungen Regelungen zur Meldefrist der Ansprüche. Diese bestimmen in der Regel, dass wenn der Eintritt der Berufsunfähigkeit später als – beispielhaft – sechs Monate nach Eintritt angezeigt wird, der Anspruch auf diese Leistung erst mit Beginn des Monats der Mitteilung bzw. der Anzeige greift. Solche Klauseln lauten beispielsweise wie folgt:
- „Wird uns die Berufsunfähigkeit später als sechs Monate nach ihrem Eintritt schriftlich mitgeteilt, so entsteht der Anspruch auf die Berufsunfähigkeitsleistungen erst mit Beginn des Monats der Mitteilung. Wird uns jedoch nachgewiesen, dass die rechtzeitige Mitteilung ohne Verschulden unterblieben ist, werden wir rückwirkend ab Beginn des auf den Eintritt der Berufsunfähigkeit folgenden Monats leisten.“
Bei einer solchen Meldefrist handelt es sich um eine Ausschlussfrist und nicht etwa um eine (verhüllte) Obliegenheit. Das Interesse des Versicherers an der Vermeidung weiter zurückliegender unbekannter Ansprüche setzt sich insoweit durch. Zu beachten ist in diesem Zusammenhang, dass sich der Versicherer nicht auf die Frist berufen darf, wenn den Versicherungsnehmer – was dieser auch zu beweisen hat – kein Verschulden trifft. Dies gilt insbesondere in Fällen, in denen es dem Versicherten aus physischen oder psychischen Gründen unmöglich war, den Versicherer zu informieren oder informieren zu lassen.
Bereits einfache Fahrlässigkeit ist schädlich
Grundsätzlich ist bereits die einfache Fahrlässigkeit schädlich. Diese ist schon dann anzunehmen, wenn der Versicherungsnehmer seine Versicherungsbedingungen prüfen konnte. Die bloße Behauptung, diese nicht gelesen oder nicht verstanden zu haben, vermag den Versicherten dabei nicht zu entschuldigen. Darüber hinaus ist bei der Ermittlung des Verschuldensgrades erschwerend für den Versicherungsnehmer zu berücksichtigen, dass die Meldefrist ausschließlich in den Bedingungen geregelt ist. Aus diesem Grund wird angenommen, dass jeder, der die einschlägigen Bedingungen nicht zur Kenntnis nimmt, grundsätzlich fahrlässig handelt.
Schweigepflichtentbindung nicht abgegeben?
Weiterhin stellt sich die Frage, wie es sich auf die Verjährung der BU-Ansprüche auswirkt, wenn der Versicherungsnehmer die geforderte Schweigepflichtentbindung nicht abgibt. Denn gerade in der Berufsunfähigkeitsversicherung ist der Versicherer auf die Erhebung personenbezogener Gesundheitsdaten bei Dritten angewiesen. Ohne die Vorlage der erforderlichen Daten wird die Leistungsprüfung konterkariert.
In der Folge ist von einem Verzicht des Versicherungsnehmers auf seinen Leistungsanspruch auszugehen, wenn dieser die erforderlichen Informationen nicht an den Versicherer weiterleitet. Beansprucht der Versicherungsnehmer Leistungen nach einem behaupteten Versicherungsfall und will der Versicherer seine Leistungspflicht prüfen, so führt die Verweigerung einer Einwilligung oder der Widerspruch zunächst dazu, dass der Versicherer seine Erhebungen nicht abschließen kann, Fälligkeit also nicht eintritt. Diese fehlende Fälligkeit zieht indessen nicht nach sich, dass der Anspruch nicht zu verjähren beginnt. Durfte der Versicherer also die von ihm erbetenen Auskünfte verlangen und hat sich der Versicherte der Mitwirkung treuwidrig verweigert, so ist ein fiktiver Verjährungsbeginn zu dem Zeitpunkt anzunehmen, zu dem der Versicherer aufgrund einer hypothetischen, sachlich gebotenen Schweigepflichtentbindungserklärung die erforderlichen Informationen erhalten hätte.
Fazit und Praxishinweise
Die Verjährungsregeln gelten sowohl für den Versicherer als auch für den Versicherungsnehmer. Dementsprechend muss derjenige die Einrede der Verjährung beweisen, der sich darauf beruft. Da zudem in vielen Versicherungsverträgen eine Meldefrist vereinbart wird, ist es für Versicherungsnehmer wichtig, den Leistungsantrag rechtzeitig zu stellen. Ohne Vereinbarung einer solchen Meldefrist verjähren die Ansprüche aus der Berufsunfähigkeitsversicherung jedoch erst nach drei Jahren. Es ist schließlich ratsam, eine Schweigepflichtentbindung abzugeben, um einen fiktiven Verjährungsbeginn zu vermeiden.
Weitere wissenswerte Beiträge zum Bereich der Berufsunfähigkeitsversicherung sind hier auf der Website der Kanzlei Jöhnke & Reichow zu finden.
Diese BU-Kolumnen wurden besonders häufig gelesen
Lesen Sie weitere relevante BU-Kolumnenbeiträge von Björn Thorben M. Jöhnke wie
Bild: © Studio_East – stock.adobe.com; © Kanzlei Jöhnke & Reichow Rechtsanwälte