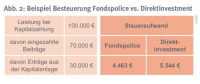Aktive ETFs verbuchen deutliches Wachstum
Scope hat eine umfangreiche Studie zum Thema aktive ETFs angefertigt. Die aktiven Ableger der klassischerweise passiv gemanagten, börsengehandelten Fonds versuchen, die Vorteile von ETFs und aktiven Fonds zu vereinen, indem sie sich zwar an einer Benchmark orientieren, ein Portfoliomanager die Allokation jedoch an die Marktverhältnisse anpassen kann. Die niedrigen Kosten und die Transparenz sowie die fortlaufende Handelbarkeit, die als große Vorteile von ETFs gelten, sollen dabei erhalten bleiben.
In Deutschland sind aktive ETFs noch vergleichsweise wenig bekannt. Doch sie gewinnen laut der Scope Analyse an Zulauf. Das Analysehaus hat insgesamt 62 einschlägige Produkte untersucht, davon 37 für Aktien und 25 für Anleihen. Dabei handelt es sich um alle in Deutschland verfügbaren aktiven ETFs. Zwölf Asset-Manager sind in diesem Segment aktiv – sowohl etablierte Anbieter aktiv gemanagter Fonds wie PIMCO, Fidelity oder J.P. Morgan als auch reine ETF-Häuser wie Ossiam, VanEck oder First Trust. Seit der Scope-Untersuchung 2022 sind mit abrdn und AXA zwei Gesellschaften hinzugekommen.
Deutlicher Anstieg bei aktiven ETFs
Zunächst lässt sich festhalten, dass laut Scope das verwaltete Vermögen im Vergleich zur letzten Analyse im Juli 2022 deutlich gestiegen ist – von rund 18 Mrd. Euro auf rund 26 Mrd. Euro. Die Anzahl der aktiven ETFs lag letztes Jahr noch bei 50. Die meisten werden dabei von J.P. Morgan (17) und Fidelity (13) gestellt. Auf Platz 3 folgt die französische Gesellschaft Ossiam mit neun Produkten. Gemessen am verwalteten Vermögen liegt J.P. Morgan mit 32% des in aktiven ETFs allokierten Kapitals deutlich vorne. Auf Platz 2 liegt PIMCO mit 21%, dritter ist Ossiam mit 19%. Fidelity liegt auf Rang 4 mit 17%. Alle übrigen Anbieter haben der Untersuchung zufolge Marktanteile von weniger als 5%, vier davon sogar von weniger als 0,5%.
J.P. Morgen und Ossiam konnten ihre Präsenz in diesem Marktsegment deutlich ausbauen. Ossiam stellt mit dem „Shifter Barclays CAPE US Sector Value“ auch den größten aktiven ETF nach verwaltetem Vermögen (etwa 3 Mrd. Euro) PIMCO dagegen musste Abflüsse in Milliardenhöhe hinnehmen und verlor dadurch den Spitzenplatz aus dem Vorjahr. Fidelity konnte seinen Marktanteil weitgehend behaupten.
Darin investieren aktive ETFs
Die meisten aktiven ETFs finden Anleger in den Peergroups Aktien Nachhaltigkeit/Ethik Welt, Aktien Nordamerika und Aktien Welt. Beim verwalteten Vermögen liegt die Peergroup Aktien Nordamerika mit 7,9 Mrd. Euro vorn, die sich auf sechs Produkte verteilen. Scope zufolge liege dies an den sehr guten Ergebnissen einiger Produkte, denen eine Outperformance gelungen ist, und die daher von den Anlegern mit Mittelzuflüssen belohnt werden. Renditetechnisch schlagen sich abgesehen davon auch Dividenden-ETFs sehr gut. Auf der Anleihenseite zeigen vor allem die Peergroups aus dem Kurzläufer-Bereich (Euro bzw. US-Dollar) ansehnliche Ergebnisse gegenüber Benchmark und Vergleichsgruppe.
Die Zukunft der aktiven ETFs
Dass sich aktive ETFs bislang nicht in der Breite durchsetzen konnten, hat nach Ansicht von Scope vor allem zwei Gründe. Zum einen fehle es bei vielen Produkten noch an einer ausreichenden Historie (26 von 62 analysierten Fonds sind weniger als drei Jahre alt). Dadurch könne man die Leistung schwerer beurteilen. Zum anderen seien die aktiven ETFs aufgrund fehlender Bestandsprovision und geringer Gebühren für Fondsgesellschaften und Finanzberater weniger lukrativ und geben daher wenig Anreiz, vertrieben zu werden. Nach Vorliegen einer Historie von mindestens drei, besser fünf Jahren allerdings könnten aktive ETFs künftig insbesondere für institutionelle Kunden und private Selbstentscheider sehr interessant werden, so Scope. (mki)
Weitere Informationen zu der Scope-Studie gibt es hier.
Bild: © AD – stock.adobe.com