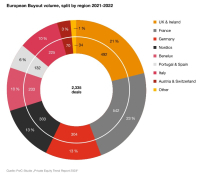Rezession in Europa: Kommt sie oder kommt sie nicht?
Portfoliomanager, Anlageberater und allgemein Dienstleister in der Investmentbranche sind momentan wohl nur schwer zu beneiden. Denn die Märkte entwickeln sich derzeit häufig unvorhersehbar, sind dementsprechend schwer zu lesen. In solch einem volatilen Umfeld sind Anlageentscheidungen schwierig zu treffen. Und genau unter diesem Motto fand am Mittwoch, 03.05.2023, die zweite Investmentkonferenz von Amundi statt: „Wohlstand sichern in einer volatilen Welt“.
Mehrere Experten des französischen Vermögensverwalters versuchten in der zweistündigen Veranstaltung, moderiert von ntv-Wirtschaftsjournalistin Sabrina Marggraf, Licht ins Dunkel der wirtschaftlichen Zukunft zu bringen.
Kommt die Rezession oder kommt sie nicht?
Thomas Kruse, CIO von Amundi Deutschland, und Prof. Dr. Michael Heise, ehemaliger Chefvolkswirt der Allianz und seit 2020 Beiratsmitglied bei Amundi, beschäftigten sich in erster Linie mit der Frage „Rezession in Deutschland: ja oder nein?“ und insbesondere Prof. Heise sieht die Frage nicht ganz so pessimistisch. Er rechne eher mit einem „schwachen Wachstum“. Bereits letztes Jahr wurde über eine mögliche Rezession gesprochen, die aber trotz der enormen Belastungen wie dem Ukraine-Krieg oder dem „beispiellosen Energiepreisschock“ ausblieb. Die Eurozone habe sich dementsprechend deutlich besser geschlagen als gedacht.
Dennoch glaubt Heise an ein eher schwaches Wirtschaftswachstum, denn die Belastungen seien eben noch nicht alle vorbei. Die Inflation ist noch sehr hoch, zehrt an der Kaufkraft der Bürger und werde, so Heise, auch nur teilweise durch Lohnerhöhungen kompensiert. Außerdem seien Kredite weiterhin etwas knapp. Positiv anzumerken sei aber, dass der Euroraum besser abschneiden werde als die US-Wirtschaft, da Europa stärker vom Rückgang der Energiepreise und vom wirtschaftlichen Aufschwung in China profitiere, der nach dem Exit aus der Zero-Covid-Politik einsetzte.
Amundi führte während der Konferenz auch Umfragen unter den rund 1.100 Zuschauern durch – die erste war gleich die Einschätzung, ob diese in Deutschland mit einer Rezession rechnen. Das Ergebnis war sehr ausgeglichen. 52% glaubten nicht an eine Rezession, 48% schon. Für Thomas Kruse bestätige dies die These von Prof. Heise, nämlich dass sich wahrscheinlich keine Rezession, sondern ein nur gemächliches Wachstum einstellen werde.
Geopolitische Risiken und Geldanlage
Ein großer Bestandteil der Konferenz war auch ein Vortrag von Anna Rosenberg, der Expertin für geopolitische Risiken bei Amundi. In den letzten Jahren sei ihren Aussagen zufolge die Geopolitik ein immer wichtigerer Aspekt der Finanzmärkte geworden, insbesondere seit dem Brexit und der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten im Herbst 2016. Durch die Corona-Pandemie sei dieser Prozess noch verschnellert worden. Viele Länder würden jetzt mehr Entscheidungen treffen, die in ihrem eigenen strategischen Interesse sind. Dies führe zu mehr Friktion, zu mehr Verhandlungen und bilde somit für Unternehmen eine schwierigere Grundlage, erfolgreich zu sein.
Ein großer Faktor im Rahmen der geopolitischen Risiken ist Rosenberg zufolge die Spannung zwischen den USA und China. Denn das „Reich der Mitte“ trete als neuer Akteur auf der Weltbühne wesentlich proaktiver auf. Zwischen den beiden Großmächten werde es nach Rosenbergs Ansicht in den nächsten Jahren einen Abwärtstrend geben – abhängig davon, welche Rolle China im Ukraine-Krieg spielen wird und wie sich der Konflikt mit Taiwan weiterentwickelt. Sollte China Waffen an Russland liefern, würde dies einen Bruch mit der Europäischen Union bedeuten. Da China dies, so Rosenberg, nicht anstrebt, halte Amundi dies für unwahrscheinlich – außer in dem Fall, dass sich eine Niederlage Russlands im Ukraine-Krieg abzeichnen sollte, oder aber die Beziehung Chinas zu den Vereinigten Staaten zerbricht.
Als Anleger müsse man in einem derartigen geopolitischen Umfeld genau darauf schauen, welche Aspekte des Weltgeschehens marktrelevant sind, beobachten, wer welche Entscheidungen trifft und was daraufhin passiert. Geopolitische Risiken spielen bei Amundi eine immer größere Rolle im Haus. Rosenberg arbeitet seit Herbst 2022 als Head of Geopolitics bei der Investmentgesellschaft. Helen Windischbauer, Managerin für Multi-Assets, betonte in der Diskussionsrunde, dass man auch ein Stück weit in die Zukunft vorausdenken müsse. Bei Amundi gebe es diverse Arbeitsgruppen, die sich mit Geopolitik beschäftigen und deren Meinungen direkt in die Makrostrategie des Hauses einfließen würden. (mki)
Bild: © kora_sun – stock.adobe.com