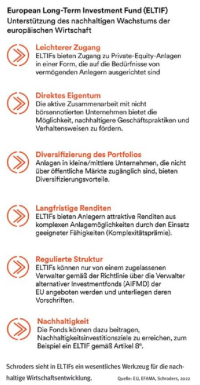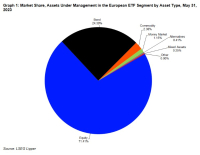Honorarbasierter Ansatz: „Glauben, dass Anleger davon profitieren“
Interview mit Thomas Meinke, Investment Strategist und Vice President bei Dimensional Fund Advisors Deutschland
Herr Meinke, Dimensional Fund Advisors bestreitet seit über 40 Jahren das Investmentgeschäft. Wie schlägt man sich im aktuellen Marktumfeld?
Die vergangenen Jahre waren für Investoren schwierig, weil es viele wirtschaftliche und gesellschaftliche Unsicherheiten gab. So haben die Aktienmärkte in den letzten drei Kalenderjahren zwei Schritte nach vorn und einen zurück gemacht. Der Gesamttrend war aber gut für Anleger, die Disziplin bewahren und damit die Aktienprämie abschöpfen konnten. Unser deutsches Geschäft läuft ebenfalls sehr gut. Wir hatten im vergangenen Jahr Rekordzuflüsse, was wir der erfolgreichen Zusammenarbeit mit den von uns betreuten Beratern und deren ausgezeichneten Kundenbeziehungen zurechnen.
Ihr Unternehmen zeichnet sich durch einen wissenschaftlich orientierten Investmentansatz aus. Was sind die tragenden Säulen dieses Ansatzes?
Die Finanzwissenschaft lehrt uns, dass liquide Kapitalmärkte effiziente Informationsverarbeitungsmaschinen sind und aktuelle Marktpreise deshalb eine faire, realistische Bewertung darstellen. Beispielsweise lässt sich dies aus verschiedensten Studien der letzten Jahrzehnte ableiten, die den Erfolg traditioneller Fonds analysiert haben. Die meisten aktiven Fondsmanager konnten ihre Benchmark über längere Zeiträume nicht übertreffen. Und die wenigen erfolgreichen Manager konnten dies in den Folgejahren nicht zuverlässig fortsetzen, was es sehr schwierig macht, diese Manager im Voraus zu erkennen.
Unserer Meinung nach können Anleger auch ohne eine Kristallkugel erfolgreich investieren. Wir denken, dass aktuelle Marktpreise zuverlässige Informationen über erwartete Renditen enthalten. Deshalb verwenden wir Preise in Verbindung mit fundamentalen Unternehmensdaten, um sogenannte „Faktorprämien“ zu identifizieren. Diese Prämien erklären im Großen und Ganzen die historischen Renditeunterschiede in den Aktien- und Anleihemärkten. Manche der empirischen Nachweise reichen sogar ein knappes Jahrhundert zurück.
Braucht man dafür nicht ein speziell geschultes Personal mit einer besonderen Vor-/Ausbildung?
In bestimmten Bereichen ja. Unser Forschungsteam besteht zum Beispiel aus einer Vielzahl von Doktoranden aus den Disziplinen Finanzen, Wirtschaft und Physik. Die Arbeit meiner Kollegen ähnelt dabei der universitärer Wissenschaftler. Wir profitieren auch von der Erfahrung und der wissenschaftlichen Akribie mehrerer Akademiker wie z. B. der beiden Nobelpreisträger Eugene Fama und Robert Merton sowie der renommierten Finanzmarktforscher Ken French und Robert Novy-Marx, die uns allesamt beratend unterstützen.
Wie gelangen Sie an die relevanten Daten, die Sie für diesen Investmentansatz brauchen?
Wir verwenden verschiedene externe Datenanbieter sowie eigenständig gesammelte Daten in unserem Anlageprozess, also zu Forschungszwecken, bei der Portfoliostrukturierung und -verwaltung sowie beim Wertpapierhandel. Allein unsere interne Handelsdatenbank sammelt täglich Marktdaten von ungefähr 90 Millionen Transaktionen für rund 19.000 Wertpapiere aus 47 Ländern. Daneben verwenden wir auch frei zugängliche Datenquellen für die Forschung. Beispielsweise veröffentlicht das Center for Research in Security Prices in Zusammenarbeit mit Ken French Faktordaten, unter anderem die sogenannten Fama-French-Indizes. Unserer Meinung nach ist das der Goldstandard, um zu verstehen, welchen Mehrwert Faktorprämien bieten.
Zu welchen Kriterien führt die wissenschaftliche Herangehensweise bei der Anlageauswahl? Sind es andere als sonst?
In der Forschung schauen wir insbesondere darauf, ob eine neu gewonnene Erkenntnis robusten Tests standhält und verlässlich unseren bestehenden Anlageprozess verbessern kann. Wir setzen uns dabei eine hohe Messlatte, da in den letzten Jahrzehnten ein wahrer „Faktorenzoo“ entstanden ist und mehr als 450 Merkmale beschrieben wurden, die auf dem Papier historische Renditen erklären konnten. Unsere Forschungsergebnisse werden von einigen der Besten in der Finanzwissenschaft auf Verlässlichkeit und Umsetzbarkeit geprüft, bevor wir Änderungen an unserem Anlageansatz in Betracht ziehen. Eine theoretische Grundlage zu haben, ist noch nicht viel wert, die eigentliche Umsetzung ist am Ende des Tages das Entscheidende.
Bei Aktien setzen wir bei all unseren Strategien beispielsweise auf die Size-, Value- und die Profitabilitätsprämie: Kleinere Unternehmen, auch Small Caps genannt, haben in der Vergangenheit im Durchschnitt höhere Renditen abgeworfen als größere Unternehmen. Unternehmen mit einem niedrigeren relativen Preis, also günstiger bewertete Value-Titel, haben sich langfristig ebenfalls besser entwickelt. Und wir schauen auf die operative Profitabilität, wobei profitablere Unternehmen andere auf lange Sicht übertreffen konnten. Neben diesen langfristigen Treibern setzen wir auch auf kurzfristigere Effekte wie die Momentumprämie. Obwohl wir wissen, dass diese Faktoren die Wertentwicklung treiben, sind die Prämien durchaus auch mal negativ. Deshalb ist auch Anlagedisziplin ein wichtiger Bestandteil unserer Investmentphilosophie, insbesondere in volatilen Zeiten.
Was ist das Ergebnis? Worin wird am Ende tatsächlich investiert?
Unsere Strategien sind breit diversifizierte Multifaktor-Lösungen. Je nach Anlageziel richten wir eine Strategie unterschiedlich stark auf die Marktbereiche aus, die eine höhere Rendite versprechen. Beispielsweise hält unsere weltweit investierte Gesamtmarktlösung physisch mehr als 10.000 Aktien und peilt dabei ein moderates Prämien-Exposure an. Solch eine Strategie investiert marktweit und setzt dabei systematisch auf kleinere, günstiger bewertete und profitablere Unternehmen, indem diese im Vergleich zur Marktgewichtung verstärkt gehalten werden. Im Gegensatz dazu investieren unsere Value- bzw. Small-Cap-Strategien hauptsächlich nur in die Value- oder Small-Cap-Aktien unseres Anlageuniversums, die anderen Prämien werden dann innerhalb dieser Anlageklassen ebenfalls umgesetzt.
Landen diese Investments in traditionelleren Ansätzen nicht im Portfolio? Und warum nicht?
Einige davon schon. Wir halten jedoch normalerweise fast alle Aktien des Anlageuniversums einer jeweiligen Strategie, was unsere Value-Strategien beispielsweise von einem traditionellen Value-Ansatz unterscheidet. Ein klassischer Manager investiert vielleicht in eine zweistellige Anzahl von Unternehmen aufgrund von Prognosen oder einer Timing-Strategie. Wir wollen nicht auf eine konzentrierte Teilmenge von Aktien wetten oder darauf, ob heute ein günstiger Kaufzeitpunkt ist. Man kann nach aktuellem Wissensstand nicht klar ermitteln, welche Unternehmen wann die Prämien liefern werden. Jedoch lassen sich Prämien umso verlässlicher abschöpfen, je mehr Unternehmen man in der relevanten Anlageklasse konsequent hält, tagein tagaus.
Und wie sieht es mit dem Thema Nachhaltigkeit aus?
Wir bieten spezielle Nachhaltigkeitsstrategien an, die in erster Linie auf einen geringeren CO2-Fußabdruck ausgerichtet sind und Anlegern die Möglichkeit geben, ihre persönlichen Werte in ihrem Portfolio abzubilden. Gleichzeitig folgen unsere Strategien weiterhin soliden Anlageprinzipien wie dem Fokus auf Prämien, breite Diversifikation und niedrige Kosten. So halten unsere nachhaltigen Aktienstrategien immer noch Tausende Titel, und das bei einer Verwaltungsgebühr wie bei einer vergleichbaren Nicht-ESG-Strategie. Für uns ist wichtig, bei Nachhaltigkeitslösungen die gleichen wissenschaftlichen Standards anzuwenden wie bei allen anderen Strategien. Unter anderem deshalb haben wir uns gegen subjektivere Kriterien wie beispielsweise ESG-Ratings entschieden. Stattdessen setzen wir auf objektivere und konsistentere Kennzahlen wie Treibhausgasemissionen.
Der Vertrieb erfolgt über Honorarberater und über Fondspolicen. Wieso die Einschränkung?
Seit wir vor mehr als 30 Jahren die Zusammenarbeit mit Finanzberatern begonnen haben, schätzen wir den Service, den ein Berater seinen Kunden bietet, sei es die Erstellung eines Finanzplans oder bei der laufenden Unterstützung, sich daran zu halten. Außerdem ist die Beziehung zwischen einem Kunden und seinem Berater unserer Meinung nach stärker, wenn der Kunde weiß, dass der Berater für ihn arbeitet und ihn direkt bezahlt.
Sie verfügen mit Dimensional 360 über ein eigenes Programm, das sich dezidiert an Finanzberater richtet. Was beinhaltet dieses?
Dimensional 360 ist unser Serviceangebot für Finanzberater und beschreibt unser Unterstützungsprogramm für Kunden rund um Investmentlösungen, Unternehmensstrategie und Kundenkommunikation. Unser Grundsatz ist, dass wir von dem Erfolg unserer Kunden ebenfalls profitieren können. Deshalb helfen wir Unternehmen entlang ihres Wachstumspfads so gut wie möglich, damit sie ihre Geschäftsziele schneller erreichen können.
Wie entwickelt sich das Geschäft in Deutschland mit Fondspolicen?
Das Geschäft mit Fondspolicen ist für uns in Deutschland ein wichtiger Wachstumstreiber. Wir sehen, dass Berater unsere Fonds aus verschiedenen Gründen im Versicherungsmantel einsetzen, von Nachlassplanung und Steueroptimierung bis hin zu Sparplänen für den Ruhestand. Sie alle haben eine Gemeinsamkeit, nämlich einen langfristigen und disziplinierten Anlageansatz, der sehr gut mit unserer eigenen Investmentphilosophie übereinstimmt.
ETFs sind ebenfalls beliebte Investmentvehikel – auch in Fondspolicen. Wie sehr unterscheiden sich ETFs von Ihrem Angebot?
ETFs sind üblicherweise indexnachbildende Anlagestrategien. Sie sind ein guter Ausgangspunkt für Anleger, da sie einen diversifizierten und kostengünstigen Zugang zu den Märkten bieten. Wir sehen unseren Anlageansatz als logische Weiterentwicklung reiner Indexfonds.
Einerseits wurden Indexfonds erfunden, bevor die Finanzwissenschaft Faktorprämien nachweisen konnte und damit ein echter Wissenssprung gelang. Wir wollen mit unseren Strategien die Vorteile eines Indexfonds beibehalten und gleichzeitig höhere erwartete Renditen auf Grundlage neuester Forschungsergebnisse bieten.
Andererseits passen wir die Positionen in unseren Strategien tagtäglich nuanciert an, um „Style Drift“ zu vermeiden, einen durch seltenes Rebalancing entstehenden Effekt, der die Faktorprämien verwässert. Das sieht man häufig bei klassischen ETFs oder Smart-Beta-ETFs, die unserer Meinung nach nur oberflächlich smart aussehen. Unser Anlageprozess ist also deutlich flexibler, was gleichzeitig hilft, die versteckten Transaktionskosten von Indexfonds zu vermeiden, wenn diese zu festgelegten Terminen rebalancieren müssen.
Wie unterstützen Sie die Berater im Rahmen der neuen ESG-Abfragepflicht?
Wir haben unseren Kunden proaktiv geholfen, die drei verschiedenen Nachhaltigkeitspräferenzen der Regulierung besser zu verstehen. Beispielsweise haben wir Vorträge gehalten und dabei die Methoden, Datenverfügbarkeit und weitere Feinheiten jeder Kategorie näher beleuchtet. Wir haben auch Workshops organisiert, um gemeinsam die Herausforderungen zu diskutieren, denen unsere Kunden mit den neuen regulatorischen Anforderungen gegenüberstehen. Da sich die Regulierung noch im Anfangsstadium befindet, werden wir unsere Kunden auch in Zukunft weiter unterstützen, und zwar aus dem gleichen wissenschaftlichen Blickwinkel wie bei allen anderen Bereichen unseres Anlageprozesses.
Die Europäische Kommission hat kürzlich auf ihre Pläne zur Durchsetzung eines strikten Provisionsverbots verzichtet. Können Sie nachvollziehen, warum man nicht einfach dem Kunden die Wahl lässt?
Wir haben uns nicht aktiv für ein Provisionsverbot eingesetzt, aber wir haben weltweit die Vorzüge eines transparenten honorarbasierten Ansatzes gesehen, bei dem die Anreize für Berater und Kunde im Einklang stehen. Unserer Erfahrung nach schaffen Berater ihren Kunden durch ihre Dienstleistungen einen klaren Mehrwert, und Kunden sind mehr als bereit, für diese Dienstleistungen zu bezahlen, wenn sie die Vorteile verstehen. Aus diesem Grund verbringen wir viel Zeit damit, Berater bei der Formulierung und Feinabstimmung ihres Leistungsversprechens und Serviceangebots zu unterstützen.
Sie selbst zahlen keine Provisionen. Spielt das Thema insofern für Sie überhaupt keine Rolle?
Seit der Gründung unseres Unternehmens haben wir niemals herkömmliche Verkaufsprovisionen gezahlt. Wir glauben, dass Anleger von einem transparenten honorarbasierten Ansatz profitieren. Deshalb haben wir uns dafür entschieden, nur mit Beratern zusammenzuarbeiten, die von ihren Kunden bezahlt werden. Dieses Modell hat für uns, die mit uns kooperierenden Finanzberater und deren Kunden bis heute sehr gut funktioniert.
Über Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors ist ein 1981 gegründetes Investmentunternehmen mit Sitz im US-Bundesstaat Texas.
Weltweit werden 566 Mrd. Euro an Vermögen verwaltet (per 31.03.2023). Die Investmentphilosophie basiert auf der Verarbeitung wissenschaftlicher Forschungsergebnisse in praktische Anlagelösungen. Auf Beraterseite arbeitet Dimensional viel mit Honorarberatern zusammen.
Diesen Artikel lesen Sie auch in AssCompact 06/2023, S. 60 ff., und in unserem ePaper.
Bild: © Thomas Meinke, Dimensional Fund Advisors Deutschland
 Thomas Meinke
Thomas Meinke